
Literarische Blitzableiter
Die Xenien von Goethe und Schiller waren zu Zeiten der Weimarer Klassik ein echter Skandal. Nun erscheint eine Auswahl der bitterbösen Spottverse als Neuausgabe bei Reclam.
Nie haben Schiller und Goethe so produktiv zusammengearbeitet wie an den Xenien, einer Sammlung von Epigrammen mit zum Teil heftigen Angriffen auf beinahe die gesamte kulturelle Szene ihrer Zeit. Als sie als Teil des „Musenalmanachs für das Jahr 1797“ anonym veröffentlicht wurden, lösten sie einen Skandal in der Klassikstadt Weimar aus.
Wir sprachen darüber mit Marcel Lepper (Jg. 1977), Literaturwissenschaftler und Honorarprofessor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Leipzig. Von 2020 bis 2022 war er Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs in der Klassik Stiftung Weimar. Seit April 2022 ist er Geschäftsführer der Carl Friedrich von Siemens Stiftung. Gemeinsam mit Frieder von Ammon, Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Leipzig, ist er Herausgeber einer Auswahl der Xenien von Goethe und Schiller, die im Mai 2022 im Reclam-Verlag erscheint.
MdM: Herr Professor Lepper, was sagen uns die Xenien über ihre Entstehungszeit und über den Literaturbetrieb, in dem sich Schiller und Goethe damals bewegt haben?
LEPPER: Die Xenien sind im verdichteten Literaturbetrieb um das Jahr 1800 ein echtes Kommunikationsereignis. Kommunikation findet in der Zeit über Zeitschriftenbeiträge und Rezensionen statt. Goethe und Schiller stellen das um: Sie nutzen eine antike Form wie das Distichon, um zeitgenössisch nicht nur zu reflektieren und zu rezensieren, sondern auch, um direkt und angriffslustig zu interagieren. Das ist also die Erfindung eines kommunikativen Instruments.
Schiller hat die Xenien als „Pfähle im Fleisch der Kollegen“ bezeichnet. Sind es also auch Reaktionen, die ein Missfallen Schillers und Goethes gegenüber der Kollegenschaft oder dem Publikum ausdrücken?
Für beide sind die Xenien so etwas wie literarische Blitzableiter. Da ist sehr viel angestauter Missmut, nicht nur den Literaturbetrieb betreffend, sondern auch andere zeitgenössische Phänomene. Es ist das Jahrzehnt nach der Französischen Revolution; Sansculottismus und konkurrierende politische Strömungen werden hier unmittelbar kritisch kommentiert. Goethe und Schiller befinden sich in dieser Phase in einer arrivierten Position: Beide haben ein Alter erreicht, in dem sie sich gegenüber der vorangehenden Generation, aber auch gegenüber ihrer eigenen ein herausgehobenes Urteil erlauben. Der aufgestaute Zorn hat aber trotzdem auch etwas Spielerisches: Da ist eine provokatorische Geste, die mit befreiendem Spott herausplatzt.
Von wem ging die Initiative zu den „Xenien“ aus? Und was sagt uns das über die Beziehung zwischen Goethe und Schiller zu diesem Zeitpunkt?
Goethe ist aus Italien zurück, Schiller in Jena mit einer außerordentlichen Professur ausgestattet, beide sind in Zeitschriftenprojekten engagiert und laborieren an den Konsequenzen von 1789. Eine Konstellation also, die endlich, ja erstmalig ein Zusammenwirken überhaupt ermöglicht. Die Initiative zu den Xenien kommt von Goethe. Schiller greift das unmittelbar auf und ist dann sehr lebhaft autorschaftlich involviert. Es ist mitzudenken, dass man über gemeinsame Feinde Nähe aufbauen kann; das Phänomen kennen wir auch heute: Verständnis stabilisieren durch Spott. Die beiden haben einfach einen höllischen Spaß daran, denn die Arriviertheit bringt notgedrungen Effekte der Langeweile, der Ausgeruhtheit, vielleicht sogar der Melancholie mit sich. Die Xenien wirken hier wie eine literarische Verjüngungskur, fast als würden sich die beiden, die altersmäßig ein Jahrzehnt trennt, noch einmal im Hörsaal Zettelchen hin und her schreiben. Das ist eine Form des Gesellschaftsspiels, aber es hat einen literaturpolitischen Anspruch, der sofort als solcher verstanden worden ist.
Man sagt mitunter, Goethe und Schiller hätten nie so eng zusammengearbeitet wie in dieser Phase. Warum ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt und bei diesem Projekt?
Da stellt sich die Frage: Was heißt „enge Zusammenarbeit“? Ich würde es messen an der Kommunikationsverdichtung. Oder auch an der Verschworenheit: Zu Missetaten muss man sich erst einmal verabreden. Das Projekt schweißt zusammen, das ist ein bisschen wie Pferdestehlen. Wenn man Aggressionen streut, muss man sich im aggressiven Urteil erst einmal einig werden. Man muss sich versprechen, dass man nicht anfängt, diese Aggressivität nach innen zu kehren – was auch nicht stattfindet. Die Xenien sind ein starkes Signal des Schulterschlusses nach außen.
Wie würden sie die Reaktionen beschreiben derjenigen, die in den Xenien gescholten werden, aber auch unbeteiligter Dritter?
Das Echo ist durchaus geteilt. Die literarische Mitwelt reagiert belustigt, verärgert oder irritiert, aber bestätigt zugleich die Unwiderstehlichkeit der Idee, wenn sie in den Antworten die literarische Form der Distichen aufgreift. Es ist eine Form, die man füllen und zurückspielen kann. Daneben gibt es aber auch Beteiligte, die sich nicht provozieren lassen. Nicht wenige literarische und journalistische Beobachter fanden das Ganze befremdlich – kommunikativ zwar reizvoll, aber nicht friedensfördernd. Man darf gleichzeitig nicht unterschätzen, dass auch das Gelächter sehr groß war.
Schadenfreude also auch?
Durchaus! Man muss sich vergegenwärtigen: Es ging um die großen Player im literarischen Feld, bei denen sich kaum jemand getraut hatte, etwas wirklich Böses zu sagen. Das wirkt enorm befreiend. In dieser Zeit gibt es im höfischen Kontext ein Gefühl für Takt – für das Decorum – also das, was man tut und nicht tut. Mit den Xenien wurden Grenzen erreicht. Es handelt sich glücklicherweise um eine Form, die nicht auf brachiale Weise versucht, ein Programm durchzusetzen, sondern immer hochgradig spielerisch und verrätselt ist. Wir haben es nicht mit schwerfälligen Pamphleten zu tun, die an die Kirchen- oder Schlosstore genagelt werden, um die Welt herauszufordern, sondern mit einer extrem volatilen Produktion, einem poetischen Pfeilhagel. Man kann trotzdem nicht sagen, hier sei der Tatbestand der Beleidigung erfüllt. Durch die Art der formalen Verklausulierung, der mythologischen Codierung, der ironischen Reflexion ist die Aggression ganz gut gebändigt.
Den Gemeinten war aber sicherlich klar, dass sie gemeint waren – und die meisten Beobachter wussten wohl auch, auf wen die Spitzen sich richteten?
Ja, tatsächlich. Die Treffsicherheit innerhalb der literarischen Szene ist hoch. Es erinnert ein wenig an Twitter: eine Art von Insider-Kommunikation, bei der alle dort Beteiligten wissen, wer kritisiert wird, auch wenn es sich nur um eine Anspielung handelt. Es gab viele Mitlesende, auch Gruppen von Anhängern oder Schülern im Umkreis der Beteiligten – und ein Publikum, das solch eine Art der literarischen Auseinandersetzung natürlich vor allem unterhaltsam fand.
Ist Ihnen irgendeine der Spitzen gegen die schreibenden Kollegen als besonders originell oder gewagt in Erinnerung geblieben?
Sehr interessant ist exemplarisch der ganze Komplex um den Aufklärer Friedrich Nicolai aus Berlin, der zu jener Zeit hocherfolgreich war und einen beachtlichen Verbreitungsgrad erzielte mit seiner Art von Trivialphilosophie, abzielend auf ein weites Publikum, mit Reiseschriftstellerei und ähnlichen populären Genres. Er ist wirklich eine Hassfigur, die immer und immer wieder vorkommt, auf die sich die Xenien regelrecht einschießen. Kritisiert wird an Nicolai nicht nur seine intellektuelle Flachheit, sondern sein schlechter Stil, seine argumentative Redundanz. Es gibt Distichen, die durch penetrante Wortwiederholungen vorführen, wie wenig Nicolai seinen Leserinnen und Lesern zutraut.

„Goethe und Schiller, das ist eben nicht nur Menschheitspathos, sondern auch eine aktive Auseinandersetzung mit der Literatur und Politik ihrer Zeit.“
Zwar erreichten die Xenien damals ein großes Publikum, heute sind sie aber sicherlich nicht das erste, was man mit der Zusammenarbeit von Schiller und Goethe assoziiert. Warum ist das so?
Ich sehe dafür drei Gründe. Erstens passen die Xenien nicht so recht ins Bild: Der Klassik-Begriff steht für Ausgewogenheit und Vorbildlichkeit, für Menschheits- und Freundschaftsideale, nicht für so eine Art von literarischem Krawall, wie wir ihn eher bei Voltaire oder, in der Moderne, bei Karl Kraus erwarten. Dazu sei auch erwähnt, dass Goethe und Schiller die Xenien nicht in ihre Werkausgaben aufnahmen: Sie waren nicht stolz auf dieses Projekt, sondern begriffen es als eine Art von Ausbruch.
Der zweite Grund ist die Form: die antikisierende Form des Distichons, die mit zeitgenössischen Inhalten befüllt ist – das macht die Xenien in höchstem Maße voraussetzungsreich. Auch darin bestand ja ein Teil der Aggressivität: dass sich Beteiligte schon deshalb exkludiert fühlten, weil sie weder mit dieser Form noch mit den Anspielungen etwas anfangen konnten.
Der dritte Grund schließlich liegt in der sehr komplizierten Entstehungs- und Überlieferungssituation. Andere Werkkomplexe bei Goethe und Schiller sind leichter zu fassen. Hier hingegen ist die Lage besonders unübersichtlich: So es gibt zuerst, wenn man so will, die Zettelchen-Schreiberei zwischen den beiden: in Briefen, die hin- und hergehen; dann eine Sammelhandschrift, drei Drucke, Nachträge und natürlich die ganzen Reaktionen – das ist ein regelrechtes Wimmelbild, was die ganze Sache so reizvoll und auch so komplex macht.
Und warum jetzt die Neuausgabe?
Der Reclam-Verlag hat die Xenien zuletzt vor mehr als 100 Jahren veröffentlicht und seitdem nie wieder. Es ist somit auch eine Form der Vergegenwärtigung zu einem Zeitpunkt, an dem es sinnvoll erscheint, die drei genannten Aspekte ins Spiel zu bringen: „Goethe und Schiller“, das ist eben nicht nur Menschheitspathos, sondern auch eine aktive Auseinandersetzung mit der Literatur und Politik ihrer Zeit. Die Komplexität literarischer Formen, der inhaltliche Anspruch wie auch das Thema der Überlieferung sind allesamt etwas, das wir uns zumuten können – und müssen. So kommt man weg einem „Mozartkugel-Bild“ Goethes und Schillers, einer Vorstellung also, die goldig und süß ist, aber eben auch langweilig und kitschig.
Wie setzt die Neuausgabe diese kritische Kontextualisierung und Zuordnung um?
Für das allgemeine Publikum ist vor allem ein Einstieg wichtig, darum bringen wir eine Auswahl der Xenien, und zwar nicht in historisch-kritischer Kleinteiligkeit, sonst würde das Ganze im ersten Schritt unlesbar. Das vollständige Bild wird die digitale Neuedition aller Goethe-Gedichte mit Handschriften und Erstdrucken bieten, die wir parallel in diesem Frühjahr 2022 in Weimar begonnen haben. Wir präsentieren bei Reclam eine – so hoffen wir – kluge Auswahl der Distichen, mit der sowohl dem Formwillen der beteiligten Autoren Rechnung getragen wird – sprich: kein Rosinenpicken – und gleichzeitig dort Akzente gesetzt werden, wo ein Rezeptionsinteresse besonders groß ist. Also: nicht solche Epigramme, die sich an historischen Figuren der dritten oder vierten Reihe abarbeiten, die heute keiner mehr kennt. Aber dafür beispielsweise jene Xenien, die sich mit Demokratietheorie beschäftigen. Ein erheblicher Teil dieser Distichen befasst sich damit, welches die beste Form von Staatlichkeit wäre oder was es heißt, die Bürgerinnen und Bürger an politischen Prozessen zu beteiligen. Sie sind von einer Skepsis unterlegt, die aus der Ernüchterungsphase nach dem großen Terror herrührt. Solche Zusammenhänge kann und sollte man öffentlich sichtbar machen. Wir stellen dazu eine editorische Notiz, einen schlanken Stellenkommentar und ein Nachwort bereit, die dann auch zeigen, auf welche Person, welchen Zusammenhang sich das jeweilige Epigramm bezieht. Anreichern werden wir das Ganze mit Bildern aus der Überlieferung, damit man sich vorstellen kann, wie dieses Kommunikationsereignis historisch ausgesehen hat.
Was möchten Sie und Ihr Co-Herausgeber den heutigen Leserinnen und Lesern mit diesem Buch mitgeben?
Wir wollen zunächst auf ein sehr spannendes historisches Ereignis aufmerksam machen – einen kulturgeschichtlichen Knall, dessen Echo auch ein Heute erreicht. Hinzu kommt, ohne einen falschen Aktualismus zu bemühen, eine gesellschaftspolitische Reflexionsabsicht: Was heißt es, mit verbaler Aggressivität, wie wir sie aktuell im öffentlichen Diskurs en masse beobachten, umzugehen? Welche Formen finden wir zur Deeskalation – und sei es nur, indem wir verbale Attacken in reflektierte Formen bringen? So wird die Gereiztheit vielleicht nicht entschärft, aber doch gebändigt.
Stichwort Aktualität: Im Rahmen des „Themenjahres Sprache“ sollen 2022 auch neue Xenien entstehen. Wie darf man sich das vorstellen?
Wir haben eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren angesprochen, Lyrikerinnen und Lyriker, die neue Xenien schreiben werden. Konkrete Namen möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten, da wir zunächst unter den Einreichungen der Aufgeforderten eine Auswahl treffen müssen. Es ist eine Art Wette, die man natürlich auch verlieren kann, wenn Gegenwartsautorinnen zu dieser Xenien-Form nichts einfällt. Doch wir sehen bereits, dass vielen etwas dazu einfallen wird – und das hat auch Gründe. Schon in konfliktgeladenen Situationen im 20. Jahrhundert sind neue Xenien entstanden. Es ist ein Prozess der Verlebendigung: Wie kann man diesen Funken nutzen – nicht zum Zündeln, sondern um die Energie, die in der historischen Idee steckt, in der Gegenwart zum Leuchten zu bringen? Wir sind sehr gespannt auf die neuen Xenien, die über die Zeitgrenzen hinweg den Dialog aufnehmen.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Lepper.
Die Fragen stellte Frank Kaltofen (Redaktion Mitteldeutsches Magazin).
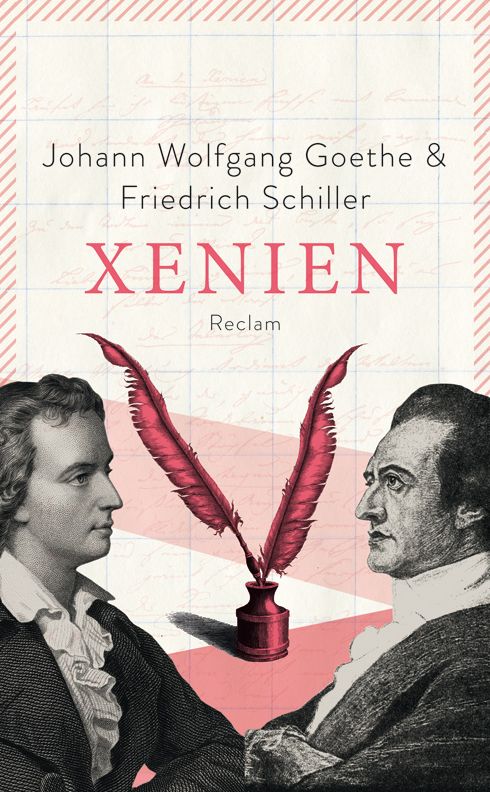
Johann Wolfgang Goethe; Friedrich Schiller: Xenien
Eine Auswahl
Hrsg. von Frieder von Ammon und Marcel Lepper
Reclam Verlag
96 S.