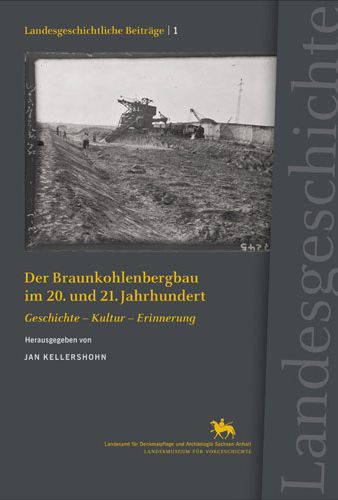
Rezension:
Zwischen Monumentalität und dem Unheimlichen
Eine transregionale Auseinandersetzung mit dem Braunkohlenbergbau.
von Mareike Pampus
Braunkohlenbergbau ist eine Industrie der Extreme: Er erschafft und zerstört zugleich, treibt Fortschritt voran und hinterlässt Verwüstung, prägt Identität und symbolisiert Wandel. Diese Ambivalenzen prägen den von Jan Kellershohn herausgegebenen Sammelband, der die Geschichte des Braunkohlenbergbaus transregional beleuchtet. Der Braunkohlenbergbau im 20. und 21. Jahrhundert. Geschichte – Kultur – Erinnerung vereint 14 Beiträge aus Geschichtswissenschaft, Geographie, Denkmalpflege und Kulturanthropologie und zeigt, wie tief der Bergbau in soziale, ökonomische und kulturelle Strukturen eingeschrieben ist.
Bereits in der Einleitung setzt Kellershohn einen spannenden interpretativen Rahmen: Er greift das Konzept des „Unheimlichen“ auf, das Sigmund Freud als das plötzlich Fremdwerdende des Vertrauten beschrieb. Der Braunkohlenbergbau erscheint in diesem Sinne als eine Praxis, die vertraute Landschaften in „unheimliche“, transformierte Orte verwandelt. Diese Perspektive durchzieht viele der Beiträge: Sei es die museale Bewahrung industrieller Relikte (Könnicke), die Erhaltung von Bergbaufolgelandschaften als potenzielle UNESCO-Welterbestätten (Hagemann) oder die Rekultivierung devastierter Flächen (Baumert). Die Industriekultur des Bergbaus bewegt sich zwischen Verklärung und Reflexion, zwischen Bewahrung und Umgestaltung.
Zeitschichten des Bergbaus: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft
Ein zentrales Thema des Bandes ist die Zeitlichkeit des Braunkohlenbergbaus. Die Beiträge verdeutlichen, dass Bergbau nicht nur Landschaften umgestaltet, sondern auch Zeitrelationen neu strukturiert. Das Kapitel von Friedrich et al. etwa zeichnet die 45 Millionen Jahre umfassende geologische und kulturelle Geschichte des Geiseltals nach, die durch den Braunkohleabbau und seine Fossilienfunde zugleich zerstört und sichtbar gemacht wurde. Schiedlowski wiederum beschreibt den Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier sehr gelungen als Prozess der „zeitlichen Re-Orientierung“: Der Braunkohleausstieg wird dabei nicht nur als wirtschaftliche, sondern als zeitspezifische Herausforderung verstanden. Wie kann sich eine Region, die jahrzehntelang auf Kohle basierte, in eine post-fossile Zukunft transformieren? Die Beiträge von Möller und Schuchard zeigen, dass die Zeitlichkeit des Bergbaus auch gesellschaftliche Brüche erzeugt. Der Ausstieg aus der Kohle bringt nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine kulturelle Entwurzelung mit sich.
Interessant ist auch, wie das Buch mit dem Phänomen der Industriekultur umgeht. Wagner diskutiert die „Musealisierung“ der Industrievergangenheit, insbesondere am Beispiel des Festivals „Futur21“ in der Region Westfalen-Lippe, das mit digitalen Installationen neue Wege der Erinnerungskultur beschritt. Auch hier wird die Spannung zwischen Vergangenheit und Zukunft deutlich: Industriekultur kann entweder zur erstarrten Nostalgie oder zum experimentellen Zukunftslabor werden.
Braunkohle als transregionales Phänomen
Ein weiteres verbindendes Element der Beiträge ist die transregionale Perspektive, die es erlaubt, über die Problematiken des mitteldeutschen Braunkohlereviers hinauszuschauen und in Vergleich zu setzen. Weiss argumentiert, dass Bergbaugeschichte zu oft als lokal verankerte Wirtschaftsgeschichte betrachtet wird, während ihre transregionalen Verflechtungen zu wenig Beachtung finden.
Das Buch
Jan Kellershohn (Hg.):
Der Braunkohlenbergbau im 20. und 21. Jahrhundert. Geschichte – Kultur – Erinnerung
Landesgeschichtliche Beiträge 1
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt
304 Seiten
Die Geschichte des Bergbaus ist eng mit Energiepolitiken, Rohstoffmärkten und Protestbewegungen verflochten. Besonders deutlich wird dies im Beitrag über die Energiepolitik Bayerns nach 1945 (Ertl). Die Braunkohle Bayerns wurde nicht isoliert betrachtet, sondern in das größere Netz der Energieversorgung eingebunden, das sich bis nach Sachsen und in die Sowjetische Besatzungszone erstreckte.
Rekultivierung: Industriekultur nach der Industrie
Ein wiederkehrendes Motiv des Bandes ist die Frage, was mit ehemaligen Tagebauflächen passiert. Baumert diskutiert die Rekultivierung in der DDR, die nicht nur ökologische, sondern auch ideologische Funktion hatte: Der sozialistische Staat verstand sich als Gestalter von Landschaft, der die „Fehlentwicklungen“ kapitalistischer Rohstoffausbeutung korrigieren wollte. Die Seenlandschaften, die heute viele Tagebaue ersetzen, sind jedoch nicht nur Zeugnisse vermeintlich erfolgreicher Renaturierung, sondern auch Symbole eines ambivalenten Erbes. In Könnickes Kapitel wird das Museum als Ort verhandelt, der diese Geschichte erzählbar macht. Er fragt, wie ein „Braunkohlemuseum der Zukunft“ aussehen könnte, das nicht nur die Technikgeschichte, sondern auch die sozialen und ökologischen Konsequenzen des Bergbaus thematisiert. Dies ist eine zentrale Herausforderung: Industriekultur kann leicht in eine reine Feier vergangener Leistung abgleiten. Ein kritisches Museum würde hingegen das Spannungsfeld zwischen Fortschritt und Zerstörung in den Mittelpunkt rücken.
Der Braunkohlenbergbau im 20. und 21. Jahrhundert ist ein facettenreicher Sammelband, der es schafft, eine Vielzahl an Perspektiven zusammenzuführen, ohne in Beliebigkeit zu verfallen. Die thematische Klammer des „Unheimlichen“, die Kellershohn in der Einleitung einbringt, ist ein wirkungsvolles Konzept, das viele der Diskussionen zusammenhält. Besonders stark sind die Beiträge, die die zeitlichen, transregionalen und kulturellen Dimensionen des Bergbaus verknüpfen. Einige Kapitel hätten noch stärker in den Dialog miteinander treten können, beispielsweise durch einen explizierten Bezug zur Einleitung. Nichtsdestotrotz bietet der Band eine wertvolle, analytisch dichte Auseinandersetzung mit der Braunkohle als industrie-, sozial- und umweltgeschichtlichem Phänomen.
Besonders für eine mitteldeutsche Leserschaft, die mit dem Strukturwandel der eigenen Region konfrontiert ist, bietet das Buch wertvolle Denkanstöße und überregionale Anknüpfungspunkte. Der Sammelband zeigt, dass Braunkohle weit mehr als ein fossiler Brennstoff ist – sie ist ein Narrativ, das verhandelt, erinnert und neu geschrieben werden muss.
Die Rezensentin:
Dr. Mareike Pampus ist promovierte Ethnologin und wissenschaftliche Mit-arbeiterin am Institut für Strukturwandel und Nachhaltigkeit (HALIS) sowie an der Humangeographie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. In ihrer Post-doc-Forschung im Fach Geographie beschäftigt sie sich mit verschiedenen Konzepten von „Natur“ in Renaturierungsprozessen von Bergbaufolgelandschaften.